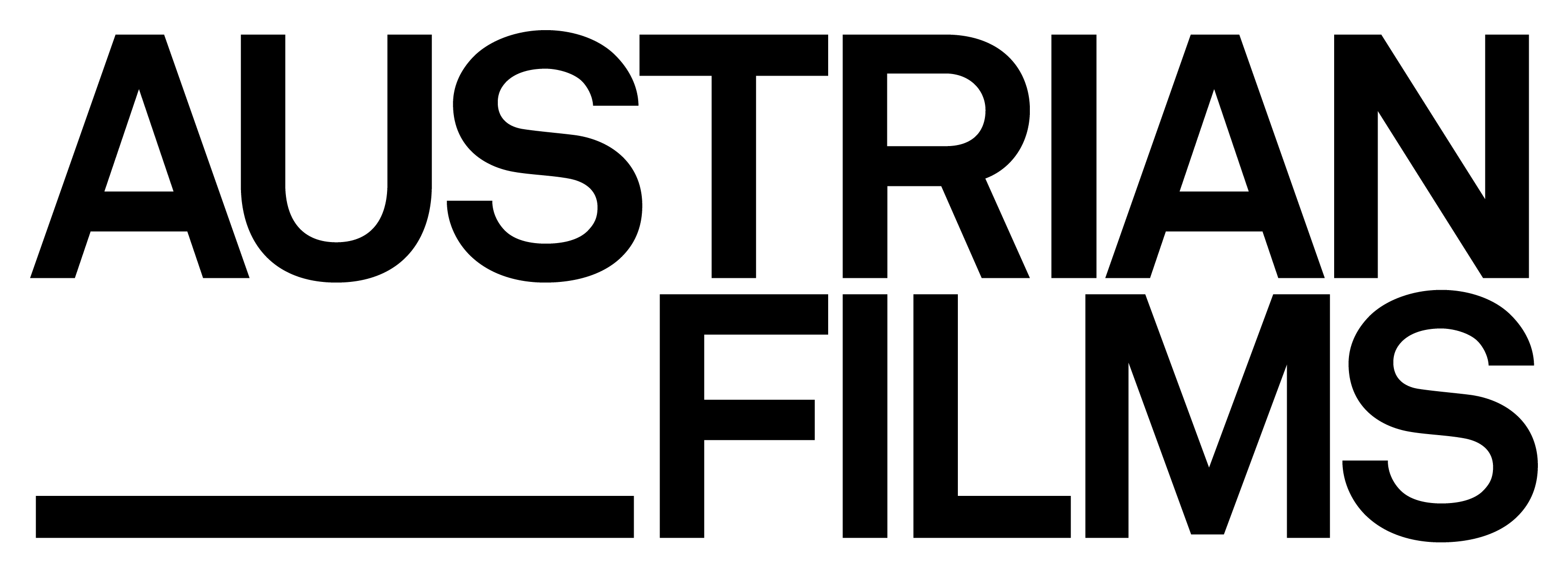Schon als Kind entdeckt Josef in den frühen dreißiger Jahren seine Berufung – die des Fotografen – und auch die Liebe seines
Lebens – Ragusa. Doch der Krieg treibt ihn fort und macht ihn samt seiner Kamera zum Zeugen unvorstellbarer Gewalt. Herzens-
und Schuldgefühle führen ihn 30 Jahre später zurück in sein Dorf, wo fast alles beim Alten geblieben ist. Peter Keglevic hat
für seinen Film AM ENDE WIRD ALLES SICHTBAR einen historischen Kontext gewählt, um immer wieder erwachende politische Mechanismen und einen recht aktuellen Umgang mit
der Wahrheit zu reflektieren.
August Schmölzer, der Darsteller des Polizeipräsidenten im Film, hat eine Heimkehrer-Geschichte geschrieben. Sein Roman Der
Totengräber im Buchsbaum lieferte Motive für Ihren Film AM ENDE WIRD ALLES SICHTBAR. Welche Themen aus dieser literarischen
Quelle haben die Basis für das Drehbuch gebildet?
PETER KEGLEVIC: Die beiden Hauptgedanken des Romans – Liebe und Schuld – sind auch im Film vorhanden. Auf diverse Details mussten wir leider
verzichten, sonst wäre der Film dreimal so lange geworden. Zum Beispiel hätte ich gerne das spartanische Leben am Land über
den Zeitraum der vier Jahreszeiten stärker eingebaut. Alles, was bei August Schmölzer geschrieben ist, hat den Charakter des
Ursprungs und dies auch im Kontext der Landwirtschaft zu erzählen, hätte mir gefallen, war aber leider nicht machbar. Ich
habe Augusts Roman als ein unglaublich präzises und poetisches Werk entdeckt, das mit Anteilnahme und Fürsorglichkeit geschrieben
ist. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Es war nicht so einfach, für diesen aus vielfältigen Gedanken zusammengesetzten Roman
eine Form der fortlaufenden Geschichte zu finden, daher beruht das Drehbuch, das ich zusammen mit meinem Ko-Autor Klaus Pohl
entwickelt habe, auf drei Ebenen: der Thematik des Heimkehrers, der Rückblende der Liebesgeschichte zwischen Josef und Ragusa
und dem Verborgenen dieser Geschichte – das schlechte Gewissen und die Schuld. Aus diesen drei Strängen entstand eine mehr
oder weniger lineare Geschichte.
Verfolgen Sie in der filmischen Erzählung diese drei Aspekte auch bis an den Ursprung?
PETER KEGLEVIC: Die Hauptfigur Josef kehrt nach sehr vielen Jahren der Abwesenheit in sein Dorf zurück, weil er sich vergewissern will, ob
seine einzige Liebe, der er dort in seiner Kindheit begegnet ist, noch da ist. Als er feststellt, dass diese Frau immer noch
in diesem Dorf lebt, wird das Rückerleben dieser ersten Liebe etwas zutiefst Menschliches. Die erste Liebe ist so großartig,
weil sie die unschuldigste ist, am wenigsten berechnend und nur vom Gedanken der Zuneigung und Hingabe bestimmt. Ein unersetzliches
Gefühl, das man später im Leben in der einen oder anderen Liebesbeziehung vielleicht auch immer wieder verliert oder nie hat.
Daher ist die Sehnsucht danach so stark. Ich habe das erstaunlicherweise in meinem Umfeld erlebt, dass man sich nach vielen
Jahren und mehreren Ehen plötzlich entsinnt, dass es da jemanden gab. Ein Bekannter von mir ist nach Kanada und hat dort seine
erste Liebe gefunden, mit der er nun wieder zusammen ist. Weil das etwas so Überwältigendes ist, kehrt mein Held Josef dorthin
zurück, woher er gekommen ist, um dieses Gefühl wieder zu erleben, zu spüren oder zu suchen.
Wichtig ist in AM ENDE WIRD ALLES SICHTBAR auch der politisch-historische Kontext: Der Ort des Geschehens könnte in Italien,
Slowenien/Kroatien oder in Österreich sein, die Zeit ist vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr zu orten. Warum haben
Sie den Kontext bewusst nicht genau präzisiert?
PETER KEGLEVIC: Die Zeit kann man relativ präzise identifizieren. Die Hauptzeit spielt um 1936, die Rückkehr um 1964/66. Wir haben zu dieser
Frage lange gerätselt und uns mit dem Autor und auch mit dem Produzenten beraten. Es schien uns zu einfach zu sagen, da ist
nun dieses Österreich, wo es politisch immer Tendenz nach rechts gibt und der Horizont von hohen Bergen gesäumt ist. Nein,
es geht um alle. Es geht um den Osten in Deutschland ebenso wie um die Anhänger von Donald Trump. Alle diese „Gesellen“ sind
vom Gedanken beseelt, dass sie einem von ihnen definierten „Anderem“ überlegen sind. Wenn sich die Politik nicht weiterentwickelt,
dann wird sie immer unter dem Motto „Das Fremde ist schuld daran“ funktionieren. Für diese Leute, die sich nie der Welt gegenüber
geöffnet haben, beginnt das Fremde jenseits von 25 km rund um ihren eigenen Nabel. Das ist hier so, in den USA oder anderswo
auch so. Wir wollten nicht, dass das Publikum von AM ENDE WIRD ALLES SICHTBAR sagen kann, So ist es in Österreich. Diese Erzählung
soll für alle gelten.
Der Film beginnt mit einer Szene in einer Dunkelkammer, wo in Josef (als Kind) der Wunsch, Fotograf zu werden erwacht. Es
ist auch eine symbolische Szene, die nach und nach Dinge zutage bringt. Liegen darin die Grundthemen des Films? Das Bildermachen
per se als Zeugnis und Kommentar der historischen Ereignisse und vor allem die Auswirkungen dessen, dass die Verbrechen der
Geschichte möglichst im Unsichtbaren gehalten werden.
PETER KEGLEVIC: Ich hätte es gerne noch ein bisschen komplexer erzählt. Es wäre aber auch zeitmäßig nicht gegangen. Ich lasse den jungen Josef
mit einem Rollfilm in der Kamera knipsen, er entwickelt, ein Foto kommt hervor. Gerne hätte ich noch stärker die Frage eingebracht,
dass es mit der Darstellung der Wahrheit nicht so einfach ist. Für die Wahrheit genügt es nicht, dass man das Fotopapier ins
Entwicklerbad wirft und dann ist sie da. Ich wollte, dass der Junge die Idee des Fotos und seines Verhältnisses zur Wahrheit
– mittels einer Lochkamera begreift, die etwas unendlich Schönes, aber auch unendlich Kompliziertes ist. Der wunderbare Hanns
Zischler, der im Film den Arzt spielt, ist übrigens ein leidenschaftlicher Lochkamera-Fotograf. Man hat eine kleine Box, da
ist nur ein kleines, verklebtes Loch vorne drin, dahinter liegt Fotopapier; man zieht die Verklebung ab und setzt es fünf
Minuten lang dem aus, was man fotografieren will. Es kommen ganz eigenartige Ergebnisse zutage, die nichts mit einer 1:1-Wiedergabe
der Wirklichkeit zu tun haben, sondern es kommt etwas zusätzlich dazu. Wie bei der Wahrheit. Da kommen auch oft noch Dinge
dazu, die man nicht erwartet hat. Für den Film hätte man immer mehrere Minuten Filmzeit gebraucht, um verständlich zu machen,
welche physikalischen Prozesse da zu greifen beginnen. Aufs Wesentliche gebracht, transportiert der Film die Idee, dass es
Geduld beim Entwickeln braucht, bis ein Bild oder die Wahrheit kommt.
Welche Gedanken verbinden Sie mit dem Beruf der Hauptfigur? Geht es um eine Figur, die auf der Suche ist, sich ein Bild von
der Wirklichkeit zu machen? Josef ist außerdem jemand der die Welt bereist hat, und auch das Andere gesehen hat?
PETER KEGLEVIC: Diese Gedanken haben am Rande gewiss auch eine Rolle gespielt. Im Zentrum stand für uns die schreckliche Bemerkung, die
der Fotograf zum Schluss der Geschichte macht – Alles, was ich fotografiere, stirbt. Diese Frage hat mich in der Recherche beschäftigt. Wim Wenders hat den wunderbaren Film über den brasilianischen Fotografen
Sebastiāo Salgado gemacht. Es handelt sich da um Völker, die am Aussterben sind. Man kann versuchen, sie mittels Fotografie
festzuhalten, dennoch kommt die Planierraupe und reißt ihnen ihre Lebensgrundlage weg. Das ist die deprimierende Erkenntnis,
die wir als Menschen oder als Fotografen, die wir den Wunsch haben, etwas zu retten oder zu erhalten, erleben: Eigentlich
töten wir alles ununterbrochen. Josef bringt das in einer etwas übersteigerten Art am Ende des Films zum Ausdruck. Als Junge,
der mit der geschenkten Leica seine ersten Bilder macht, hält er sich für einen tollen Fotografen. Sein Einsatz als Kriegsfotograf
rettet ihm vielleicht das Leben, sein erster Auftrag, den er ausführen muss, ist es allerdings, eine Erschießung zu fotografieren.
Dieses Erlebnis verfolgt Josef ein Leben lang, gleichzeitig wird es auch zugeschüttet, damit er sich nicht erinnern muss.
Wir schreiben Josef Bilder zu, die er fotografiert hat: Da sind Indigene in Feuerland, die längst ausgestorben sind. Da ist
ein Foto, das mir besonders wichtig ist, weil es einen Bezug zu Leni Riefenstahl herstellt, die immer behauptet hat, von den
Naziverbrechen nichts gewusst zu haben. Sie ist aber auf einem Foto bei einer Erschießung dabei. Wir haben in die Serie der
Fotos von Josef ein Foto hineingeschnitten, wo ihr, die gesagt hat, nichts gewusst zu haben, das Entsetzen ins Gesicht geschrieben
ist. Hier wird so einen Augenblick von Zerrissenheit vor Schuld sichtbar. Josef hat sich auch immer gesagt, nichts damit zu
tun zu haben. Er ist aber als Fotograf Zeuge von so Vielem geworden und sagt meiner Meinung nach zurecht Alles, was fotografiert wird, stirbt. Wenn das nach mehreren Jahrzehnten sein Resümee ist, dann macht es keine Freude, weiter zu fotografieren. Es lag nicht in
seinem Naturell, Supermodels oder den roten Teppich in Venedig zu fotografieren. Josef steht in seinem Leben an einem Moment
des Nicht-Wissens, wie es weitergeht. Die Rückkehr zur ersten Liebe als etwas, das unschuldig, absichtslos und abenteuerlich
und unendlich schön war, ist das Motiv für seine Rückkehr. Das Vorangegangene will er wie eine schlechtsitzende Haut abstreifen.
Für diese zugeschütteten Schuldgefühle haben Sie die Figur des Michael erfunden.
PETER KEGLEVIC: Als Drehbuchautoren standen wir vor der Frage, Wie lässt man das Gewissen sprechen? Es hätte auch eine Stimme aus dem Off
sein können. Wir erfanden einen Jungen namens Michael, der bei dieser Erschießung getötet worden ist, und der, sobald Josef
ins Dorf zurückkommt, in lebendiger Gestalt immer wieder in Josefs Gegenwart auftaucht und den er natürlich immer wieder loswerden
möchte. Es war uns wichtig, dass es keinen Touch von Geister- oder Märchenfilm bekommt. Uns schien ein Junge, der am Kamin
oder unterm Tisch sitzt und den niemand außer Josef wahrnehmen kann, die einfachste und verständlichste Form. Heute lässt
man, wenn man in Filmen SMSe sichtbar machen will, Sprechblasen auftauchen. Michael ist so etwas wie eine personifizierte
Sprechblase, die Josef unangenehme Fragen stellt. Josefs Geschichte steht für den Kampf, Schuldgefühle nicht heranzulassen.
Wenn man sich die Ketten von Erklärungen, weshalb politische Verbrechen entstanden sind, vor Augen hält, dann kommt immer
wieder die Antwort: Ich hatte ja keine andere Wahl | Ich habe meine Pflicht getan. Man will die Fakten nicht an sich heranlassen.
Die Liebesgeschichte zwischen Josef und Ragusa scheint auch die einzige Gegenkraft in einem System zu sein, wo es einzig um
Machterhalt geht.
PETER KEGLEVIC: Das ist sie automatisch. Diese wiedergefundene Zuneigung ist weitaus stärker als die hundertfach auf ihn einprasselnde Widerwärtigkeit
von Männlichkeit, Jähzorn, Ungerechtigkeit, Berechnung und Egoismus. AM ENDE WIRD ALLES SICHTBAR zeigt in historischem Gewand,
wie ungeniert die Mechanismen, die vor allem Donald Trump sichtbar gemacht hat, auch in Europa salonfähig geworden sind. Ich
erlebe es im Osten Deutschlands, es passiert wohl überall, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Mit der Lüge wird
behauptet, die Wahrheit zu sagen. Diese unerträglichen Fake-News. Im Film ist der Bürgermeister ein abscheulicher Kindermörder,
es hat aber keine Konsequenzen. Das unerträglich Rechte hat sich in den letzten 15 Jahren so wuchernd breit gemacht. Ich wollte,
dass das als Gefühl, das so unscheinbar banal, leichtfüßig und ohne konspirative Anstrengung daherkommt, zurückbleibt. Alle
kuschen und spielen das Spiel mit. Das ist für mich der allumfassende gesellschaftliche Rahmen für diese unerträglichen Machenschaften,
die so riesige Auswirkungen haben. Es geschieht als Reflex, ohne jegliche Gewissensbisse.
Ragusa ist mit und ohne Josef eine starke Figur und Persönlichkeit. Wie würden Sie sie charakterisieren?
PETER KEGLEVIC: Ragusa ist auch im Roman eine wesentliche Figur. Mir geht es nicht darum, dass eine Frau, wenn sie vierzig geworden ist,
einen tollen Charakter repräsentiert – stabil, autonom und selbstbewusst. Ragusa ist das schon als zehnjähriges Mädchen so.
Sie ist wie sprudelndes Mineralwasser und er ist das stille Wasser. Sie ist ununterbrochen agil, während er – wie es auch
dem Wesen des Fotografen entspricht – immer im Hintergrund steht. Man hat R.W. Fassbinder mal gefragt, Wo stehen Sie eigentlich politisch? Rechts oder links? Fassbinder hat geantwortet: Ich stehe hinter der Kamera. Das lernt schon der kleine Josef, dass hinter der Kamera zu sein auch bedeutet, nicht in der Lage zu sein, Einfluss zu nehmen.
Der Fotograf hält den Augenblick fest, wenn andere am Tun sind. So erlebt er auch dieses so quirlige und ohne jede Lüge behaftete
Mädchen. Ragusa hat Haltung und Charakter und das macht die anderen im Dorf wahnsinnig. Weil sie ihnen klar macht, dass sie
eine höhere Stufe erreicht hat als sie.
Ein Blick auf Ihren Cast: Wir kam es zu Ihrer Wahl von Harald Schrott und Erika Marozsán als Ihre Hauptdarsteller:innen?
PETER KEGLEVIC: Ich habe mit Harald Schrott bereits zusammengearbeitet und kannte ihn auch aus einer englischen Produktion, wo er einen Heimleiter
für geflüchtete jüdische Kinder gespielt hat. Er hat mich in dieser Rolle sehr beeindruckt, er hat so eine anständig einfache
Art, im Schauspiel zu einem guten Resultat zu kommen. Für Ragusa haben wir lange gesucht. Ich hatte einen ganz vagen Besetzungsgedanken
vor Augen, weil sie mit ihrer Freundin Olga die einzige Frau in der Geschichte ist. Die Situation erinnerte mich an Irene
Papas in Alexis Sorbas. Dieses Selbstbewusstsein war mein Character-Lead. Erika Marozsán hat in den neunziger Jahren in Gloomy
Sunday eine hinreißende Figur gespielt. Mein Produzent Wolfgang Rest hat sich auf die Suche gemacht. So kam es zu meinen beiden
Hauptdarsteller:innen, die sich ausnehmend gut miteinander verstanden haben. In aller Bescheidenheit, mit der Erika Marozsán
auftritt – das ist ja das Wunderbare, wenn man das Agile und Lebendige in einer Figur erkennt, ohne dass jemand eine großartige
Performance abliefern muss, in der permanent mitgeteilt werden muss Ich bin wer! Man schaut Ragusa an und weiß, sie ist es.
Im Wirtshaus sitzen nur Männer am Stammtisch, mauscheln nur Männer, im Orchester spielen und dirigieren Männer. Das ist z.T.
der abgebildeten Zeit geschuldet. Ist hier eine Kritik zu vernehmen, was rauskommt, wenn die Männerklüngel nicht aufbrechen?
PETER KEGLEVIC: Es ist zwangläufig ein Abbild der gewählten Zeit, wir decken den Zeitraum von Mitte 30er bis Mitte 60-er Jahre ab. Sie haben
recht, so ist es, dass die Männer alles unter sich ausmachen. Dem haben wir einen eskalierenden Schluss entgegengesetzt. Der
Polizeikommandant geht davon aus, dass ihm der Umstand, dass er Ragusa jeden Sonntag einen Blumenstrauß schenkt, irgendwann
das Recht einräumt, diese Frau zu besitzen. Und wenn dieses Kalkül nicht reibungslos aufgeht, dann hält er es für berechtigt,
sich sein Begehr mit Gewalt zu holen. Als es so weit kommt, richtet sich die Gewalt aber gegen ihn selbst. Das war der Augenblick,
wo wir gesagt haben, gegen all das kann man sich nur noch physisch wehren. Dann taucht Olga, als stummer Bodyguard auf und
schlägt zu. Möglicherweise eine traurige Schlussfolgerung: Schlag sie einfach tot! Anders kann man sich gegen so etwas nicht
wehren. Man kann das Übel nur an der Wurzel rausreißen, wenn man diese Zeitspanne verhandelt. Heute geht es vielleicht anders.
Aber ich glaube auch nicht viel.
Ihr Ausblick ist nicht sehr optimistisch: Die Kindermorde werden für die Dorfbewohner nicht aufgeklärt, sondern ein Sündenbock
muss sterben. Sie projizieren die, die im Dorf das Sagen haben und sich die Pfründe teilen, mit Handys in der Hand in die
Gegenwart, wo sie, ohne gealtert zu sein, weiter ihren Männerbund pflegen. Ändert sich nichts zum Guten?
PETER KEGLEVIC: Das ist ein wichtiger Punkt. Es sind nicht dieselben, aber es bleiben die gleichen Charaktere, die in Variationen ein System,
das ich mit Bürgermeister, Presse, Polizei und Pfarrer zeichne, weitertragen. Es werden am Ende schon Dinge sichtbar, allerdings
sind es nicht unbedingt schöne Dinge. Es ist leider ein hässliches Sichtbar-Werden. Aber wie im Entwicklerbad, wo zunächst
eine neutrale weiße Fläche wie ein scheinbar unschuldiges weißes Papier existiert, kommt nach 15, 20 Sekunden eine Wahrheit
heraus, die manchmal körnig und unscharf ist. Aber sie kommt heraus. So etwas Ähnliches macht der Film.
Auch wenn Josef aufgrund seines falsch platzierten Herzens stirbt, ist da zwischen ihm und Ragusa etwas Positives entstanden.
Es ist nur ein kurzes und winziges Glück gegenüber allem, was viel größer und schwerer in der Waagschale liegt. Auch die Freundschaft
zwischen beiden Frauen – Ragusa und Olga – ist etwas unausgesprochen Positives. Diese unendliche Möglichkeit einer Zuneigung,
das sind die kleinen positiven Sichtbarkeiten, die viel bewirkt haben.
Sehen Sie im Erzählen einer Epoche, die nun mehrere Jahrzehnte zurückliegt, eine Parallele in die Gegenwart?
PETER KEGLEVIC: Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Es gibt die Theorie, dass der Mensch im Allgemeinen gut ist. Ich glaube, dass
stimmt nicht. Das Gute in sich zu haben, zu leben und zu praktizieren, ist eine äußerst schwierige Angelegenheit. Das andere
ist einfacher. Ich habe das schreckliche Gefühl, dass der Mensch nicht da ist, um gut zu sein. Nur weil ich Angst habe, zünde
ich doch kein Flüchtlingsheim an. Das ist ein etwas pessimistischer Gedanke, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren,
wenn ich mich umschaue. Eine Liebesgeschichte eingebettet in eine Gesellschaft, die merkwürdig funktioniert, darauf wollte
ich ein Augenmerk lenken. Es ist sozial akzeptabel geworden, rechts zu sein. Nicht nur, weil man Protest oder Angst zum Ausdruck
bringen will. Diese Haltung hat sich langsam eingeschlichen und eingebürgert, ohne dass man es gemerkt hat. Das sichtbar zu
machen, war der Gedanke bei diesem Film und die gewählte Musik der Orchesterproben ist Liszts Prelude, unschuldig für die einen und missbraucht von den anderen, die sie als Kennmelodie der Nazi-Wochenschau verwendeten.
Interview: Karin Schiefer
Oktober 2023